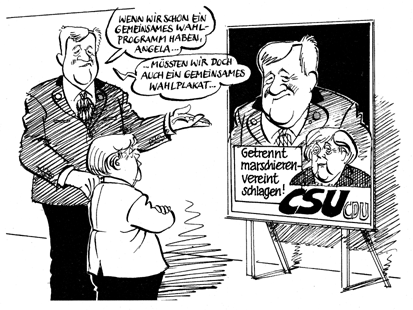Absichtserklärungen der Berliner Kassenverwalter
Der tollste rhetorische Rohrkrepierer unserer Tage ist der unsägliche Satz von den Kindern und Kindeskindern, denen wir unmöglich die Schulden hinterlassen dürften, die wir seit so vielen Jahren machen. Kaum ein Konservativer und kaum ein Liberaler, aber auch kein Sozialdemokrat, kein Grüner und kein Linker, der nicht mit sorgenvoller Miene davon schwadroniert, diese künftigen Kleinen, von denen es ohnehin noch weniger als heute geben soll, brächen dereinst unter atlasartigen Lasten zusammen, die aus heiterem Himmel über sie kämen wie Plagen im Alten Testament. Ins Bildhafte übersetzt stellt man sich irgendwie harmlose Knirpse in kurzen Hosen vor, die unter tonnenschwerem Schulterdruck kollabieren. Dabei ist die allseits so beliebte, rührende Metapher völliger Quatsch. Kein Mensch, der die armen, um ihr eigenes Glück geprellten Enkel thematisiert, will ihr Anwalt im Angesicht der Ewigkeit sein. Ganz im Gegenteil. Interessant ist ja schon die Freiheit, die jeden, der will, offenbar dazu ermächtigt, junge und jüngste Generationen als unvertretbar Leidtragende unser aller Fehlverhaltens zu beweinen und zu beklagen. Größer könnte politische Heuchelei kaum sein. Denn nichts weniger als der Schutz unschuldig in die Bredouille geratender Mädels und Buben von morgen ist intendiert. Der Plan sieht anders aus: Heute wird eine frivole Selbstentlastung konstruiert.Das fängt damit an, wen man alles auf diesem Ticket erwischt. Alte Parteigranden etwa, deren Söhne und Töchter mit rund 40 Lenzen im Zenith ihrer Leistungskraft stehen, mittelalte Hinterbänkler, die in der Familie daheim im Wahlkreis Schulpflichtige haben, aber eben auch Jungstars im Parlament, die noch gar nicht in vermehrungsorientierter Beziehung leben, so dass ihr Gebabbel von den Enkeln, die noch nicht einmal geboren sind, sogar das Risiko birgt, dass es diese überhaupt nie geben könnte. Wer also bitte ist eigentlich gemeint? Zwischen den realen Kindern der Alten und den virtuellen Enkeln der Jungen liegen hundert Jahre. Eine verräterische Unschärfe dieses seltsamen Palavers, die auf des Pudels Kern verweist. Eigentlich geht es darum, die Aussage zu machen, dass der heutige Zustand keinesfalls als »Worst case« gelten darf, und zwar unabhängig von der Höhe der Summen, die unser Staat auf seinem tiefroten Kerbholz hat. Die Lage ist ernst, aber lange noch nicht aussichtslos. Wir haben unsere Gegenwart im Griff. Das ist eindeutig eine gute Nachricht, die sich in der düsteren Prophezeiung verbirgt. Und daran halten wir uns auch. Das schaurige Gruseln, Gott sei Dank eben nicht der Gnade viel späterer Geburt zu unterfallen, mag unsere Lebenslust befeuern. Schließlich kauft die abgedroschene Phrase mit ihrem dreisten »später, später, später« Zeit. Insofern haben wir es nur mit scheinbarer Sorge um Konsequenzen unseres Handelns zu tun.Implizit sprechen wir uns also einvernehmlich die Erlaubnis zu, weiter zu machen wie bisher. Offenbar ist es noch gar nicht richtig schlimm mit den verprassten anderthalb Billionen, mit der grandios gescheiterten Haushaltskonsolidierung, mit dem weiteren Finanzierungsbedarf in und nach der großen Krise. Die Gewissen tun zwar ihre Pflicht, indem sie mahnen, dass über der laxen Gesellschaft, die wir in pervertiertem »Wohlstand für alle« präferieren, Pleitegeier kreisen, aber wir schweigen das bittere Ende, für das wir selbst zu haften haben, kollektiv still. Indessen wäre auch darauf hinzuweisen, dass die Verschiebung des finalen Kassensturzes auf den Sankt Nimmerleinstag einen Betrug an den Leistungsträgern begründet, die mit treu gezahlten hohen Steuern und Abgaben und mit ihrer teuren Daseinsvorsorge im Zeichen von Eigenverantwortung tapfer auf Vermögensbildung und Konsum verzichten. Unsere Gesellschaft ist bei aller Umverteilungsmanie von oben nach unten und von unten nach oben unsolidarisch mit dem Mittelteil geworden. Wir sollten uns bald, besser sofort besinnen.
Beste Grüße aus Bonn, Ihr Reinhard Nenzel, Chefredakteur